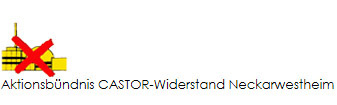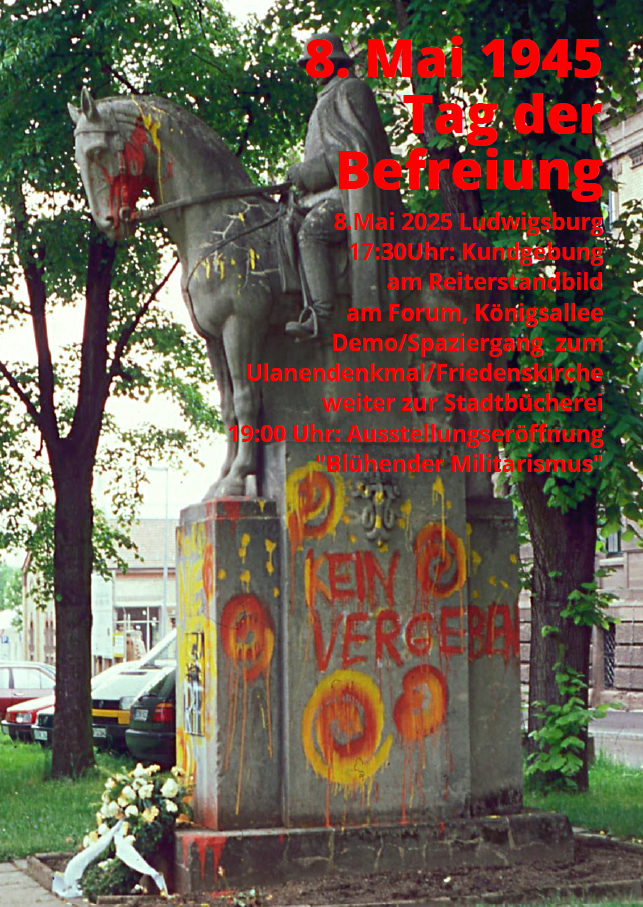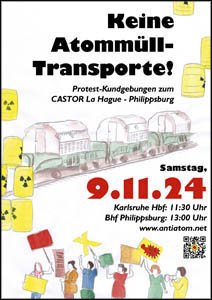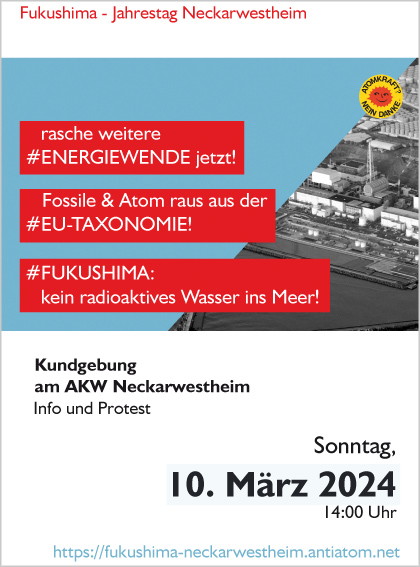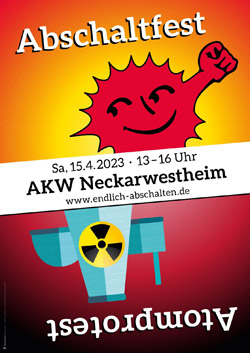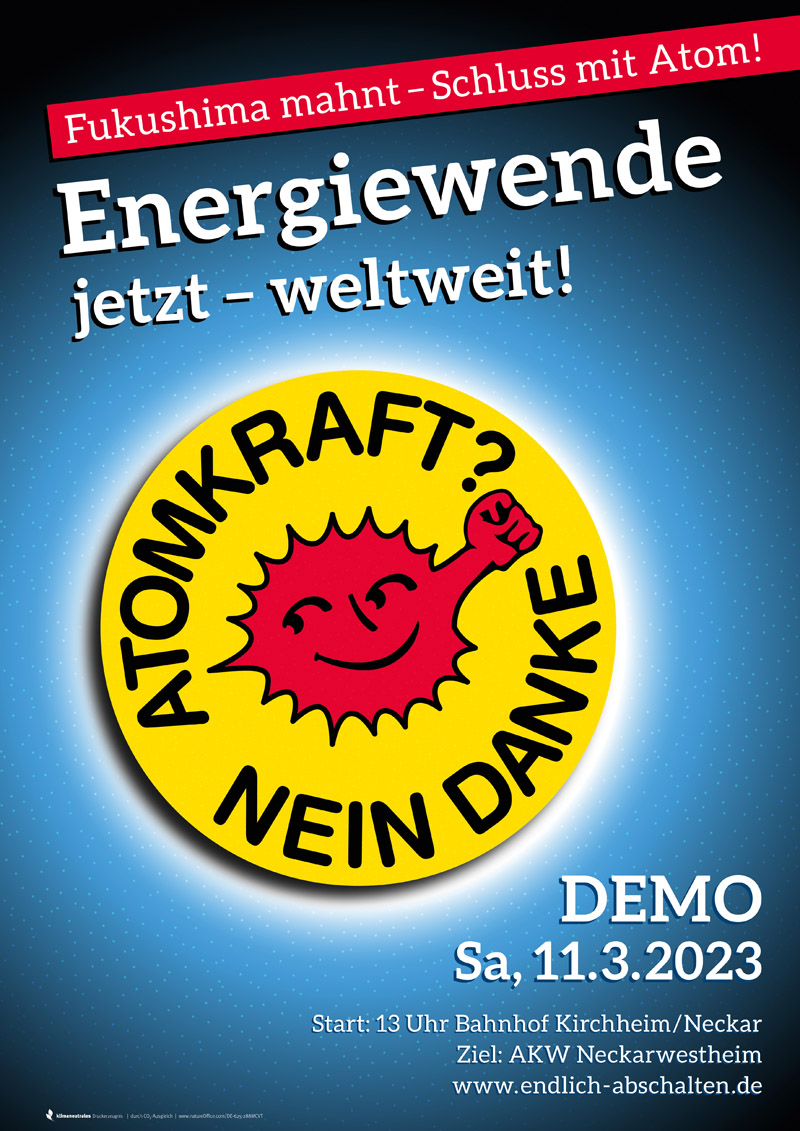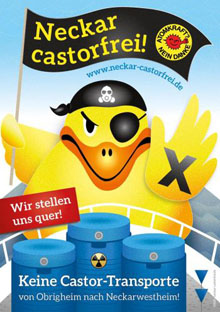- Details
Sicherheitsdefizit: Keine Materialproben mehr in Neckarwestheimer Atomkraftwerk
http://snipurl.com/y7ai2 ]
Stuttgarter Zeitung, 28.07.10
> Grüne wollen Klarheit über Atomkessel
> Kernkraft: Beim Rückbau des AKW Obrigheim fordern die Grünen eine Prüfung des
Druckbehälters.
Von Andreas Müller
Der Streit liegt rund zwei Jahrzehnte zurück, ist aber immer noch nicht abschließend geklärt.
Heftig wurde in den neunziger Jahren in der Landespolitik um das Kernkraftwerk Obrigheim
gerungen. Vor allem eine Frage entzweite damals die Kritiker und die Verteidiger des
ältesten deutschen Atommeilers: Wie ist es um die Beschaffenheit des
Reaktordruckbehälters bestellt? War der Stahlkessel samt den Schweißnähten unter der
ständigen Bestrahlung mürbe geworden, oder genügte er den Anforderungen an die
sogenannte Sprödbruchsicherheit?
Der damalige SPD-Umweltminister Harald Schäfer betrachtete den entsprechenden
Nachweis als erbracht, als er dem Altmeiler nach mehr als zwanzigjährigem Probebelauf die
Dauerbetriebsgenehmigung erteilte. Da man den Druckbehälter naturgemäß nicht selbst
untersuchen konnte, stützte er sich auf sogenannte Einhängeproben. Doch unter den
Experten - und in der Folge auch den Politikern - blieb bis zuletzt umstritten, wie
repräsentativ die Proben für das Schweißgut der kernnahen Rundnaht wirklich seien. Sowohl
hinzugezogene Gutachter als auch ein Beamter der Atomaufsicht im Umweltministerium
hegten bis zuletzt Zweifel daran.
Die Schlacht um Obrigheim ist längst geschlagen, im Zuge des Atomausstiegs wurde der
Reaktor vor fünf Jahren stillgelegt. Nun aber kommt die Versprödung des
Reaktordruckbehälters wieder auf die Tagesordnung der Landespolitik. Der derzeit laufende
Rückbau der Anlage, meint der Grünen-Abgeordnete und Fraktionsvize Franz Untersteller in
einem Parlamentsantrag, biete eine "einmalige Chance": An den einzelnen Komponenten
könne man nun direkt feststellen, wie stark sie durch die Dauerbestrahlung versprödet
waren.
Untersteller, zu Zeiten des Obrigheim-Untersuchungsausschusses s parlamentarischer
Berater, geht es "nicht etwa um nachträgliche Rechthaberei". Die Untersuchung des
Materials und der Vergleich mit den Gutachterprognosen könne wichtige Erkenntnisse für
andere ältere Reaktoren liefern, glaubt er. Die tatsächliche Versprödung könne für die
sicherheitstechnische Beurteilung dieser Anlagen "von zentraler Bedeutung" sein. In seinem
Antrag fordert er daher Auskunft, inwieweit der Betreiber, der Stromkonzern EnBW, oder die
Atomaufsicht die nachträgliche Gelegenheit nutzen wollen. Abwegig ist die Idee des Grünen
keineswegs. "Die EnBW hat diese Frage eingehend überprüft", teilte das Unternehmen der
StZ mit. Allerdings plane man "zum jetzigen Zeitpunkt keine entsprechende Untersuchung".
Darüber müsse derzeit auch nicht entschieden werden, denn diese beim Rückbau ohnehin
"erst in einigen Jahren" möglich.
Von der Prüfung erwarte man sich zudem "keine relevanten Erkenntnisse" für die in
Deutschland laufenden Kernkraftwerke, fügte der Karlsruher Konzern hinzu. Deren
Reaktordruckbehälter unterschieden sich in Materialbeschaffenheit und Fertigung stark von
dem in Obrigheim. Untersteller erhofft Erkenntnisse jedoch nicht nur für deutsche, sondern
auch für ausländische Atommeiler.
Auch die Atomaufseher von Umweltministerin Tanja Gönner (CDU) reagieren reserviert. Von
einer solchen Untersuchung erwarte man sich "keine zusätzlichen Erkenntnisse", sagt ein
Sprecher. Die Ergebnisse wären auf andere Anlagen "wohl nicht übertragbar". Das System
der Einhängeproben gebe es inzwischen in allen Reaktoren. Es habe sich bewährt, um
etwaige Veränderungen festzustellen, und genüge den internationalen Standards.
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
x ------------ X -----------
x mailinglist des
x Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
x http://neckarwestheim.antiatom.net
x aus-/eintragen: Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
x ohne Subject, im Text: un-/subscribe abc
- Details
Liebe AKW-GegnerInnen,
mit den Infos zu den folgenden beiden Terminen laden wir Euch herzlich ein, im Juli weiter
für die sofortige Stilllegung der Atomanlagen aktiv zu werden!
> Das Spiel ist aus. Abschalten!
> 04. Juli, 14.00 Uhr: Sonntagsspaziergang zum AKW Neckarwestheim
Am letzten Sonntagsspaziergang vor der Sommerpause dem Betreiber und den politisch
Verantwortlichen noch einmal deutlich die Meinung sagen. Nach nunmehr 10 Jahren
"Atomausstieg" haben wir genug von Regellaufzeiten, von Reststrommengen und der
Diskussion um die Laufzeitverlängerungen.
Atomkraft ist keine Brücken- sondern eine regenerative Verhinderungstechnologie.
Technisch könnte die Energiewende sofort durchgeführt werden. Sie muss allerdings gegen
den Willen von RWE, EON, Vattenfall und EnBW durchgesetzt werden.
Abschalten sofort - Energiewende jetzt!
Flyer-Kopiervorlage und Infos via folgenden link:
http://snipurl.com/xo125
> Atomausstieg sofort – Energiewende jetzt!
> Demo in Stuttgart am 24. Juli, Umweltministerium am Kernerplatz, 14.00 Uhr
Unter dem Slogan "Atomausstieg sofort – Energiewende jetzt! Stilllegung der
Atomkraftwerke in Neckarwestheim - sowie aller anderen Atomanlagen!" erhöhen die Anti-Atom-Initiativen am AKW-Standort Neckarwestheim jetzt noch einmal den Druck auf die
Atomkonzerne und die Politik.
Im Fokus steht insbesondere das "Musterland" Baden-Württemberg mit der bundesweit
"Roten Laterne" in Sachen erneuerbare Energie, mit seinen Politiker_innen, die sich ständig
als rücksichtslose Fürsprecher_innen der Risiko-Technologie Atomkraft positionieren, und
mit seinem omnipräsenten Atomkonzern EnBW, der nicht nur in Stuttgart neben der
Stromversorgung auch die Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung noch in seinen
Händen hält.
- Mitmachen! Dem Atomausstieg auf die Beine helfen!
- Dezentrale und bürgernahe Strukturen mit eigenen Stadtwerken und mit erneuerbaren
Energien!
- Atomausstieg jetzt – keine Laufzeitverlängerungen!
Unterstützt die Demo, beteilgt Euch und gebt die Informationen weiter!
Print-material kann in Kürze bestellt werden.
Aufruf, Flyer und Infos via folgenden link:
http://snipurl.com/xo0fa
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
- Details
> Rätsel um russisches Uran lassen EnBW kalt
Kernkraft - Landet wiederaufgearbeitetes Uran aus dem Westen in Reaktoren vom Typ
Tschernobyl?
Während ein Schweizer Atomkonzern infolge einer Greenpeace-Studie nachbohrt, will man
es im Südwesten gar nicht so genau wissen. Von Andreas Müller und Wolfgang Messner
Zwischentitel: Greenpeace-Studie entfacht Debatte über Geschäfte mit Russland.
Der Verdacht ließe sich mit einem einzigen Wort ausräumen. Kann die EnBW ausschließen,
dass wiederaufbereitetes Uran aus ihren Kernkraftwerken in Russland zu Brennstoff für
Atommeiler vom Typ Tschernobyl verarbeitet wird? Dass sie also zumindest indirekt den
Weiterbetrieb der umstrittenen Reaktoren fördert, die der Westen wegen ihrer
Sicherheilsdefizite am liebsten abgeschaltet sähe? Ein Ja würde genügen, doch eine
entsprechende StZ-Anfrage konnte oder wollte der Karlsruher Konzern so nicht beantworten.
Stattdessen vervies er auf die Anlage zu einer Studie der Umweltorganisation Greenpeace.
Ein dort wiedergegebenes Schreiben der russischen Staatsgesellschaft für Atomenergie
(Rosatom) versteht er so, dass "kein westeuropäisches Wiederaufbereitungsuran" in den
sogenannten RBMK-Reaktoren lande.
Ob der übersetzte Text wirklich diesen Schluss zulässt, sei einmal dahingestellt. Die Studie
von Greenpeace Schweiz über das "Recycling von Wiederaubereitungsuran", die im
Nachbarland erheblichen Wirbel ausgelöst hat, kommt jedenfal|s just zum gegenteiligen
Ergebnis. Darin werden genau jene Geschäfte mit Russland untersucht, die bei der EnBW
nach Sonderabschreibungen von mehr als 100 Millionen Euro ins Zwielicht geraten sind
(siehe StZ vom 21. Mai) Gegenstand sind zwar in erster Linie die "undurchschaubaren und
intransparenten" Verbindungen zwischen der eidgenössischen Atomindustrie und russischen
Brennstoffproduzenten. Aber seine auch auf Informationen der Internationalen
Atomenergieagentur (IAEA) gestützten Erkenntnisse, sagt der Autor Stefan Füglister, gälten
für die westeuropäischen Reaktorbetreiber insgesamt.
Im Fall der Schweizer Unternehmen wie der EnBW geht es um Uran aus verbrauchten
Brennelementen, das nach der Wiederaufarbeitung in La Hague oder Sellafield nach
Russland gelangt. Dort, in einer Fabrik in Elektrostal bei Moskau, wird es mit höher
angereichertem Uran aus militärischen Beständen vermischt (Experten sprechen von
"Blenden") und als neuer Brennstoff zurückgeliefert. In beiden Fällen laufen die Geschäfte
über den gleichen Vertragspartner, den französischen Atomkonzern Areva, auch die Akteure
auf russischer Seite sind die Gleichen.
Aus welchen Quellen, das war einer der Ansätze der Greenpeace-Studie,stammt das
russische Uran genau? Zum Teil aus der Abrüstung von Atomwaffen, hatte der Schweizer
Kernkraftwerksbetreiber Axpo behauptet und damit seine Umweltbilanz für den Reaktor
Beznau geschmückt.
Hochgefährliche Sprengköpfe dienen der friedlichen Stromproduktion - eine schöne Variante
der Devise Schwerter zu Pflugscharen. Indes, sie stimmte nicht. Das Recycling von
Atombomben sei "eine Mär", fand Füglister heraus,es werde vor allem Uran aus
Antriebsreaktoren von U-Booten oder Eisbrechern verwendet. Die Kraftwerksbetreiber
würden über die Herkunft bewusst im Unklaren gelassen.
Axpo fragte daraufhin bei der Lieferfirma nach und bekam die Greenpeace-Angaben
bestätigt. Das angereicherte Uran, korrigierte sich der Atomkonzern, komme zwar "teilweise
aus militärischen Quellen, aber nicht aus der Abrüstung von russischen Kernwaffen". Auch
EnBW hatte und hat offenbar keine gesicherte Erkenntnis über die Herkunft. "In welchem
Umfang Waffenuran beim Blenden verwendet wurde, ist aus den Verträgen nicht ersichtlich -
und uns daher nicht bekannt", anwortete das Unternehmen auf StZ-Anfrage. "Grundsätzlich"
stamme höher angereichertes Uran aus dem militärischen Bereich, wo es etwa in
Sehiffsantrieben genutzt werde. Konkreteres wissen die Karlsruher offenbar nicht - und
wollen es womöglich gar nicht wissen. Auf die Frage, ob man sich nach Schweizer Vorbild
mehr Transparenz wünsche. gab es keine Auskunft. Auch die Greenpeace-Erkenntnisse
über die Verwendung von westeuropäischem Uran in Reaktoren vom Typ Tschernobyl wollte
EnBW nicht weiter kommentieren. Frei nach dem Motto: "Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß"?
Die Geschäfte mit Russland, recherchierte Füglister anhand von IAEA-Angaben, seien eine
Art Tauschhandel. Mit dem angereicherten Uran bekämen die westeuropäischen
Atomkonzerne genau so viele spaltbare U-235-Anteile zurück, wie sie angeliefert hätten.
Gewichtsmäßig entspreche dies etwa einem Fünftel des Ausgangsmaterials, vier Fünftel
verblieben in Russland. In der gleichen Fabrik in Elektrostal werde daraus Brennstoff für
RBMK-Reaktoren hergestellt - und so der knapp gewordene Vorrat an Natururan geschont.
Auf Greenpeace-Nachfrage erläuterte die Staatsgesellschaft Rosatom, dass
westeuropäisches und russisches Uran zwar in der gleichen Anlage, aber zeitlich getrennt
verarbeitet würden. Doch anders als die EnBW leitet Axpo daraus nicht den Schluss ab, dass
kein Uran aus dem Westen in Atommeilern vom Typ Tschernobyl landet. Die Recherchen
der Schweizer ergaben vielmehr, dass das in Russland verbleibende Material "auch in
russischen RMBK-Reaktoren eingesetzt werden kann. Derzeit laufen bei Axpo weitere
gründliche Untersuchungen, "um die Plausibilität der Angaben über Spaltstoffflüsse zu
überprüfen".
Ein Atomkonzern muss sich in zwei zentralen Punkten von Greenpeace auf die Sprünge
helfen lassen - kein Wunder, dass in der Schweiz eine lebhafte Debatte über die
Urangeschäfte mit Russ|and entbrannt ist. Mit mehreren parlamentarischen Anträgen, in
denen mehr Transparenz verlangt wird, hat sie inzwischen auch den Ständerat und den
Nationalrat erreicht. Im benachbarten Baden-Württemberg sieht sich die Landesregierung
indes nicht gefordert, mehr Licht in die Dunkelzone zu bringen. Für die Atomaufsicht sei
relevant, dass bei Brennelementen die Sicherheitsanforderungen erfüllt würden, sagt ein
Sprecher von Umweltministerin Tanja Gönner (CDU).
Zugleich verweist er auf das internationale Spaltstoffkontrol|system, das militärische
Materialien freilich nur bedingt erfasst. Im Übrigen, sagte der Sprecher, sei Uran eben "eine
Handelsware" - wenn auch "eine besondere".
Bildunterschrift: Das Kernkraftwerk Neckarwestheim: in beiden Reaktorblöcken werden laut
Atomaufsicht und EnBW auch Brennelemente aus russischer Herstellung verwendet. Foto:
Steinert
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
x ------------ X -----------
x mailinglist des
x Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
x http://neckarwestheim.antiatom.net
x aus-/eintragen: Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
x ohne Subject, im Text: un-/subscribe abc
- Details
_http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2494071_0_9223_-neckarwestheim-r
aetselraten-um-russisches-uran.html_
(http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2494071_0_9223_-neckarwestheim-raetselraten-um-russisches-uran.html)
Neckarwestheim: Rätselraten um russisches Uran
Wer auf der Internetseite der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) den
Suchbegriff ´Russland´ eingibt, erhält vor allem Erfolgsmeldungen.
Ganz oben wird über einen hohen russischen Orden berichtet, mit dem der
frühere Konzernchef Utz Claassen angeblich als ´erster Ausländer überhaupt´
dekoriert wurde. An zweiter Stelle folgt der Besuch des russischen
Präsidenten Wladimir Putin beim EnBW-Stand auf der Hannover-Messe 2005.
Weiter unten
geht es um Gaslieferungen aus dem Osten oder um russische Sportler. Die
spannendste Meldung zu Russland, die seit Monaten Mitarbeiter, Manager und
Aufsichtsräte umtreibt, findet sich nicht in der Übersicht. Denn die
Landesbezeichnung fehlt im Text ebenso wie andere Schlüsselbegriffe. Es ist
die im
Februar veröffentlichte Pressemitteilung zu den vorläufigen Geschäftszahlen
für 2009.
Ein halber Absatz handelte darin von vorsorglichen ´Wertberichtigungen im
Kraftwerksbereich´ in der Höhe von 116,5 Millionen Euro. Verträge seien
möglicherweise nicht erfüllt worden, heißt es lapidar, man prüfe derzeit
´sämtliche Aspekte´.
Worum geht es bei den ´Wertberichtigungen´ wirklich?
Erst allmählich wird bekannt, was dahintersteckt. Mit dem
´Kraftwerksbereich´ ist die Atomsparte gemeint, in den Verträgen geht es um
hochsensible
Geschäfte mit Russland - die Lieferung von Nuklearbrennstoffen, auch aus
militärischen Beständen, oder Pläne zur Überwachung und Entsorgung von
strahlendem Material. In diesem Kontext klingt es beunruhigend, wenn das
Unternehmen ´mangelhafte Vertragserfüllung´ vermutet oder nicht sicher ist, ob
´Regeln und interne Vorgaben´ eingehalten wurden.
Wie ernst die EnBW die aus den Jahren 2005 bis 2008 datierenden Vorgänge
nimmt, zeigt ihre scharfe Reaktion. ´Umgehend´ nach deren Bekanntwerden im
vorigen Jahr - wie sie ans Licht kamen, bleibt unklar - habe man externe
Gutachter beauftragt, teilte der Stromkonzern auf StZ-Anfrage mit. Sie sollen
die ´näheren Umstände der vertraglichen Beziehungen´ durchleuchten. Die
Ergebnisse lägen noch nicht vor, parallel dazu liefen Nachverhandlungen.
Eingeschaltet ist nicht nur der Vorstand unter Utz Claassens Nachfolger
Hans-Peter Villis, sondern auch der Aufsichtsrat mit den Vertretern der
oberschwäbischen und französischen Großaktionäre. Die geben sich bei dem
heiklen Thema
äußerst zugeknöpft - es gilt offenbar die höchste Diskretionsstufe.
Auch in der Belegschaft ist nichts Näheres über die möglichen
Unregelmäßigkeiten bekannt. Umso lebhafter wird darüber spekuliert, zumal
sich bereits
irritierte Geschäftspartner erkundigen. Wo sind die abgeschriebenen
Millionen geblieben? Flossen womöglich Schmiergelder, was auch die Justiz
interessieren könnte? Oder ist gar radioaktives Material verschwunden? Auf
Letzteres gebe es ´keinerlei Hinweise´, versichert die EnBW, Erkenntnisse über
Korruption lägen nicht vor, ´derzeit´ sehe man keinen Grund für den Gang zur
Staatsanwaltschaft. Selbst die Atomaufsicht im Stuttgarter Umweltministerium
wurde bisher nicht offiziell informiert.
Ökonomie statt Ideologie
Die Untersuchungen werfen ein Schlaglicht auf eine Geschäftsbeziehung, die
bisher nicht an die große Glocke gehängt wurde. Seit den siebziger Jahren
unterhalten die deutschen Reaktorbetreiber - auch die EnBW und ihre
Vorläuferunternehmen - Kontakte in die einstige Sowjetunion. Als überall sonst
noch der Kalte Krieg herrschte, arbeitete man im Bereich der Nuklearwirtschaft
bereits gut zusammen; gemeinsame ökonomische Interessen waren wichtiger
als ideologische Differenzen.
Mit dem Fall der Blockgrenzen und der atomaren Abrüstung eröffneten sich
für die Energiebranche ganz neue Möglichkeiten. Hochangereichertes Uran aus
russischen Militärbeständen sollte fortan zu Brennelementen für westliche
Kernkraftwerke verarbeitet - und damit unschädlich gemacht werden. Die
ersten Versuche im Meiler Obrigheim verliefen Mitte der neunziger Jahre
vielversprechend, einige Jahre später wurde auch Neckarwestheim beliefert.
Gefertigt wurden die Pellets schon damals bei der Firma MSZ (Maschinstroijtelni
Zavod) Elektrostal östlich von Moskau, wo sie heute noch herkommen. Das Uran
stamme etwa aus den Reaktoren von Unterseebooten oder Eisbrechern, erläutert
die EnBW. Inwieweit auch Atomwaffen verwertet würden, wisse man nicht; das
gehe aus den Verträgen nicht hervor.
Russland konnte beim Abrüsten noch verdienen, die Energiekonzerne kamen
vergleichsweise günstig an Brennstoff - alle Seiten schienen zufrieden. Nur
alle paar Jahre flackerte in Deutschland Protest auf. Mal äußerte Greenpeace
Zweifel an den Sicherheitsbedingungen und Produktionsstandards in Russland,
mal wurde in Niedersachsen anlässlich einer Landtagsanfrage räsoniert,
welche Rolle die ´russischen Mafia´ in der Atomwirtschaft spiele. Doch mit der
Qualität der Brennelemente gab es keine Probleme, wie das für die
Atomaufsicht zuständige Stuttgarter Umweltministerium bestätigt. Bei der
mehrstufigen und engmaschigen Kontrolle - einmal reiste sogar ein Beamter aus
Baden-Württemberg nach Elektrostal - sei es nie zu Auffälligkeiten gekommen.
Die Aufseher von Ressortchefin Tanja Gönner (CDU) akzeptieren es denn
auch, dass die EnBW sie bisher nicht über die möglichen Unregelmäßigkeiten
informiert hat. Aus kaufmännischen Vorgängen, heißt es, halte man sich bewusst
heraus. Doch je nach Art etwaiger Verstöße, sagen unabhängige Experten,
könnten auch diese sicherheitsrelevant sein: dann nämlich, wenn sie Zweifel an
der Zuverlässigkeit des Betreibers nährten. Dafür habe man aber keine
Anhaltspunkte, bekunden die Kontrolleure des Landes. Ob andere
Regierungsstellen in Bund oder Land informiert sind, war von der EnBW nicht
zu erfahren.
Ratsam wäre es: Gönner und Ministerpräsident Stefan Mappus kämpfen gerade für
längere Laufzeiten der Atommeiler, da sollten sie über mögliche
Angriffsflächen Bescheid wissen.
Verbindungen nach Moskau
Zumindest in zwei Punkten wird der Karlsruher Energiekonzern auf Nachfrage
etwas konkreter. Bei den Dienstleistungen, die jetzt näher untersucht
werden, gehe es unter anderem um den Rückbau des stillgelegten Kernkraftwerks
Obrigheim. Dabei habe man geprüft, ´Bauteile in einem speziellen Ofen in
Russland einzuschmelzen und erneut dem Stoffkreislauf zuzuführen´. Bisher
wurde daraus offenbar nichts. Wenn tatsächlich Reaktorschrott gen Osten
gebracht werde, müsste das Stuttgarter Umweltministerium eingeschaltet werden -
doch dem ist nichts bekannt.
Auch sonst habe man keine strahlenden Stoffe nach Russland entsorgt,
versichert die EnBW. Genau wegen diesen Verdachts war der Großaktionär
Electricité de France (EdF) Ende vorigen Jahres in die Schlagzeilen geraten.
Viel
Wirbel gab es damals um radioaktive Rückstände aus Frankreich, die angeblich
in Sibirien unter freiem Himmel lagerten. Offiziell hieß es in beiden
Ländern indes, alles sei in bester Ordnung.
Geprüft wird nun auch ein Projekt, das die EnBW gemeinsam mit einem
umtriebigen russischen Geschäftsmann realisieren wollte. Andrej Bykov heißt der
Moskauer, der bereits vor Jahren in der Schweiz größeres Aufsehen erregte.
Die von ihm geführte Aktiengesellschaft mit dem Namen ´Nuclear Disarmament
Forum´ (Abrüstungsforum) vergab 2002 mit viel Trara mehrere Friedenspreise.
Preisträger waren unter anderem der russische Präsident Putin, der freilich
nicht persönlich erschien, und der südafrikanische Erzbischof Desmond
Tutu. Die Verleihung nahm Putins Vorgänger Michail Gorbatschow vor, moderiert
wurde der Festakt von den Showdamen Michelle Hunziker und Lolita Morena, es
musizierte das russische Nationalorchester.
Doch trotz des hohen Glamourfaktors wurde die Veranstaltung im Casino der
Stadt Zug von Misstönen begleitet. Die Schweizer Greenpeace-Organisation
bescheinigte der ´skurrilen Friedensinitiative´, sie diene nur als
imagefördernder Deckmantel für die Interessen der europäischen
Atomwirtschaft. Das
sehe man schon daran, dass das Forum einst vom Brennstoffeinkäufer des
grenznahen Reaktors Leibstadt gegründet worden sei. Auch Schweizer Zeitungen
kritisierten, ein großes Geschäft werde nach dem Motto ´Schwerter zu
Pflugscharen´ als Wohltätigkeit verbrämt. Und Regionalpolitiker aus dem
Kanton Zug
blieben dem Festakt demonstrativ fern. Bykov zeigte sich von alldem
unbeeindruckt: Er werde sich weiterhin für die Vernichtung der Atombomben
engagieren, wurde er zitiert.
Undurchsichtiges Personalgeflecht
Worum aber ging es bei den gemeinsamen Aktivitäten mit der EnBW? In zwei
Gesellschaften aus Bykovs Schweizer Firmengeflecht, die alle unter der
gleichen Zürcher Adresse (Stockerstraße 50) residierten, war der Karlsruher
Konzern hochrangig vertreten: durch den heutigen Technikvorstand Hans-Josef
Zimmer, zuvor Chef der Kernkraftgesellschaft EnKK, den langjährigen
kaufmännischen Geschäftsführer von Neckarwestheim und EnKK, Wolfgang Heni, und
den
Generalbevollmächtigten Konzernfinanzen, Ingo Peter Voigt. Mal fungierten sie
als Verwaltungsrat, mal als Geschäftsführer.
Bei einer der Firmen, ETS Premium, war Heni laut Handelsregister bis
November 2009 sogar Präsident des Verwaltungsrats. Daran erinnerte er sich indes
erst bei der zweiten StZ-Nachfrage: Den Posten habe er ´in der Tat
vergessen´. Der Zweck der Aktiengesellschaften war vage formuliert. Bei Easy
Toll
Systems, der zweiten Firma, ging es um ´Sicherheits-, Maut- und
Kontrollsysteme für Verkehr, Transport, Lagerung und Logistik´, bei ETS
Premium noch
allgemeiner um die ´Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art im In- und
Ausland´. Deutlich konkreter klingt der Geschäftszweck, mit dem die EnBW
ihre Minderheitsbeteiligung bei Easy Toll erklärt. Es sei um ein
Überwachungssystem gegangen, mit dem die Kontrolle radioaktiver Stoffe in
Russland
verbessert werden sollte; in solchen Fragen habe man schließlich Erfahrung. Der
Anstoß sei vom G-8- Gipfel 2002 gekommen, der auch ein entsprechendes
Programm beschloss. Doch die Pläne zerschlugen sich, gegenwärtig wird die Firma
liquidiert. Der Grund laut EnBW: wegen der Wirtschaftskrise wolle die
russische Regierung ´keine Mittel mehr für das Projekt bereitstellen´. Nun
endet es offenbar im Streit ums Geld.
x ------------ X -----------
x mailinglist des
x Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
x http://neckarwestheim.antiatom.net
x aus-/eintragen: Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
x ohne Subject, im Text: un-/subscribe abc
- Details
wir laden Euch herzlich zum nächsten Sonntagsspaziergang zum AKW Neckarwestheim ein!
Nach den erfolgreichen Aktionen am Tschernobylwochenende gilt es jetzt, den Druck für die
sofortige Stilllegung der AKWs gerade auch an den AKW-Standorten aufrechtzuhalten und
zu erhöhen - bevor im Herbst die nächsten "Großereignisse" anstehen!
Mit dem Motto des Anti-Atom-Spaziergangs "Gorleben ist überall" erklären wir uns
eineserseits solidarisch mit den zeitgleichen Aktionen im Wendland an diesem Wochenende:
"30 Jahre Freie Republik Wendland"! (s.u.)
Andererseits wird bei diesem Spaziergang der Castor-Transport nach Gorleben im
November dieses Jahres ein zentrales Thema sein - der Castor als einerseits als Zeichen für
die unmögliche "Lösung" des Atommüll-Problems und andererseits als Ausdruck der Stärke
und des Erfolgs des Anti-Atom-Widerstands "direkt auf der Straße".
Weitere Themen werden die Vergesellschaftung des Risikos des Betriebs der AKWs sein,
dargestellt am Beispiel der fehlenden Haftpflicht für die Atomanlagen - und es wird
informationen zum aktuellen Stand zum Bau der Windkraftanlage in Ingersheim geben.
Weitersagen - und herzliche Einladung!
> Sonntag, 06. Juni, 14.00 Uhr
> Wanderparkplatz schöne Aussicht oberhalb des AKW Neckarwestheim
--
Trotz "unseres" Sonntagsspaziergangs" raten wir allen, die das "lange Wochenende" frei
haben, sich auf den Weg nach Gorleben zu machen:
"Turm und Dorf könnt ihr zerstören, aber nicht unsere Kraft, die es schuf!"
30 Jahre Freie Republik Wendland
Aus Anlass des Jahrestags wird vom 4. bis 6. Juni an das Hüttendorf der Freien Republik
Wendland erinnert. Es sind Alle eingeladen: Alle, die damals dabei waren, Alle, die damals
noch nicht dabei waren und Alle, die noch gar nicht dabei sein konnten! Kommt und macht
mit! "Weißt du noch........" darf genausoviel Raum haben wie die gegenwärtigen Verhältnisse
und die Frage "Wo wollen wir hin und erreichen das schnellstmöglich?"
30 Jahre Republik Freies Wendland feiern wir vom Fr. 4.Juni bis So. 6.Juni 2010 an den
Atomanlagen Gorleben. Am Sa. 5.Juni wird es um 12 Uhr eine Umzinelung des Bergwerks
geben.Bitte kommt alle!
http://www.bi-luechow-dannenberg.de
--
akw-feindliche Grüße!
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
x ------------ X -----------
x mailinglist des
x Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
x http://neckarwestheim.antiatom.net
x aus-/eintragen: Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
x ohne Subject, im Text: un-/subscribe abc
- Details
------- Weitergeleitete Nachricht / Forwarded message -------
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow - Dannenberg e.V.
Rosenstr. 20
29439 Lüchow
<http://www.bi-luechow-dannenberg.de>
Büro: Tel: 05841-4684 Fax: -3197
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Pressemitteilung 3.05.10
12. Castortransport nach Gorleben genehmigt
Widerstand formiert sich schon jetzt
Der Countdown hat begonnen: heute, am 30. Jahrestag der Besetzung der
Bohrstelle 1004 in Gorleben - der legendären Republik Freies Wendland -
hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) den Transport von 11 Behältern
mit HAW - Glaskokillen aus der französischen Plutoniumschmiede Cap de La
Hague zum sogenannten Transportbehälterlager Gorleben genehmigt.
"Ein denk-würdiges Geburtstagsgeschenk", kommentiert die Bürgerinitiative
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI). Am 4./5. Juni werden einige Hundert
Freunde und Sympathisanten der Republik Freies Wendland auf ihrem Fest und
bei der beabsichtigten Umzingelung des Schwarzbaus Gorleben die ersten
Verabredungen treffen, wie im Herbst beim nächsten Castortransport die
"Abstimmung mit den Füßen" gegen Gorleben als Endlagerstandort und gegen
die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken organisiert werden kann.
Wie schon in der Vergangenheit wurden die Behälter der Serie HAW 28 M
nicht realen Belastungstests unterzogen, moniert die BI. Die Gesellschaft
für Nuklearservice (GNS) hatte zuvor einen Bauantrag zur Erweiterung des
Fasslagers gestellt, zusammen mit der betriebsbereiten
Pilot-Konditionierungsanlage (PKA) konzentriert Gorleben alle Facetten des
ursprünglich geplanten "Nuklearen Entsorgungszentrums" (NEZ) mit dem
Kernstück Atommüllendlager im Salzstock Gorleben.
Ein BI-Sprecher: "Von daher dient jeder weitere Transport der Zementierung
Gorlebens als NEZ, diese Politik, Gorleben Stück für Stück als
Atommüllzentrum durchzusetzen, verdient die richtige Antwort, den
massenhaften Protest."
--- Ende der weitergeleiteten Nachricht / End of forwarded message ---
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
- Details
"30 Jahre Widerstand - 30 jahre Freie Republik Wendland"
mit Kerstin Rudek von der BI Lüchow-Dannenberg]
Frankfurter Rundschau, 04.04.10
> Damals ist heute im Wendland
Gastbeitrag von Wolfgang Ehmke
Als am 3. Mai 1980 ein vielköpfiger Zug von Trebel aus in den Gorlebener Wald zog, dorthin,
wo die Tiefbohrung 1004 geplant war, lachte die Sonne. Und es lachten die Protestler. Sie
folgten nämlich der Bekanntmachung des Untergrundamtes 3131 Gorleben-Soll-Leben,
Postfach 1004, um einen Platz zu besetzen, und natürlich wurde als erstes ein
Freundschaftshaus gebaut.
Das sind Orte jener merkwürdigen Verquickung von Protest und Lebensfreude, Aufbegehren
und Begegnung, mit ihrem Mix aus Vortrag, Palaver und Kulturprogramm. Das hat Tradition.
Das erste Freundschaftshaus wurde bei der Platzbesetzung im Wyhler Wald errichtet.
Nach jahrelangen Auseinandersetzungen, Demonstrationen und Grenzblockaden stürmten
im Februar 1975 nach einer Kundgebung mit 28.000 Teilnehmer/innen Tausende das
Baugelände und besetzten den Platz - es war die "Geburtsstunde" der Anti-Atom-Bewegung.
Viele Geburtshelfer gab es. Da war die Bewegung in den 50er Jahren gegen den Atomtod,
gegen die drohende atomare Bewaffnung der Bundeswehr und die Gefahren der Proliferation
der Atomtechnologie, die ihren militärischen Ursprung gern verleugnete. Schließlich war da
die Studentenrevolte mit ihren Happenings: den Sit- und Go-, den Love- und Teach-Ins.
Republik mit Puppenspiel
Die Freie Republik Wendland, das Hüttendorf auf der Tiefbohrstelle 1004 über dem
Salzstock Gorleben, war das herausragende Beispiel einer Symbiose von Kunst und
Wissen/schaft. Jo Leinen hielt einen Vortrag über Friede und Ökologie. Das Puppenspiel
"Die Bundschuhbauern" wurde aufgeführt.
Walter Mossmann kam und blieb auf 1004 und kreierte das Gorlebenlied. Es gab ein eigenes
Radio, es wurde gefilmt und es gab und gibt Filme über die Platzbesetzung, jene sechs
Wochen "anarchistischen Frühlings" im Mai und Juni 1980.
Freie Republik Wendland (Bild: dpa)
Es gab Dichterlesungen mit Klaus Schlesinger, Wolf Biermann war da und der Juso Gerhard
Schröder. Es gab Rock, Folk und Blues, Schweine, Hühner, eine Solaranlage, ein
Frauenhaus und wo man hinhörte: Diskussionen. Beim Zähneputzen, Abwaschen und auf
dem Donnerbalken. Über Demokratie und Polizeigewalt, über Halbwertzeiten und
Bohrergebnisse.
Es war ein (Über-) Lebensdorf und nachhaltig, nicht nur in den Parolen, die bis heute
Bestand haben: Atomkraft nein - danke mutiert nämlich zu Sonnen-, Wind- und Wasserkraft
- ja bitte. Das Leben auf 1004 war gelebter Widerstand.
Dass Begriffe wie 1004 nicht abgegriffen sind, liegt nicht nur am anhaltenden Widerstand im
Lande gegen die Atomkraft und Gorleben als nukleares Endlager. Es liegt an der politischen
Tagesaktualität.
Erst im Sommer 2009 flog auf, dass nach Auswertung der Tiefbohrungen, zu denen 1004
gehörte, im Mai 1983 auf Weisung der Bonner Regierung unter Helmut Kohl Akten der
federführenden Behörde, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, geschönt wurden.
Bedenken wurden entschärft, die Empfehlung, andere Standorte zu untersuchen, wurde
gestrichen.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Berlin ist jetzt mit diesen Vorgängen
befasst. Auf diesem schwankenden Grund bewegt sich der Ausbau eines Bergwerks im
Gorlebener Salz als Endlager für hochradioaktive Abfälle.
Und derzeit vergeht kein Tag, an dem in den Medien nicht über den Prototyp von Gorleben,
das absaufende Atommüllendlager Asse, und Gorleben berichtet wird. Denn die Wahl
Gorlebens geschah gegen wissenschaftlichen Rat, daran knüpft heute Norbert Röttgen
(CDU), der "grüne Schwarze", an, er tarnt die Absicht, Gorleben nach dem 10jährigen
Moratorium weiter auszubauen, mit dem Begriff "Erkundung", die aber ist alternativlos -
ergebnisoffen. Da sehen wir aber schwarz für ihn.
Neuanfang
Da lachen die Protestler: Ein Freundschaftshaus in Gorleben steht schon wieder, die Bauern
haben es gebaut. Fast jeden Sonntag wird am Schwarzbau Gorleben demonstriert, jeden
Sonntag halten Christen im Wald eine Andacht.
2009 treckten wir nach Berlin, am 21. April trecken wir nach Krümmel. Wir brauchen sie
immer noch, die Freundschaftshäuser, solange der Kampf gegen die Atomkraft nicht
gewonnen und Gorleben nicht zu Fall gebracht wurde.
Am 4. und 5. Juni, 30 Jahre nach der Räumung von 1004, sind wir alle wieder da. Die "alten"
Junggebliebenen von 1980, die "jungen" Kluggewordenen der letzten Jahre. Rock, Blues,
Filme und ein Wiedersehen wird es geben, wir tanzen, klönen, diskutieren und - umzingeln
den Schwarzbau. Wie hieß es damals? "Turm und Dorf könnt Ihr Zerstören, aber nicht
unsere KRAFT, die es schuf!" Damals ist heute.
Zum Autor
Wolfgang Ehmke ist Mitgründer der Bürgerinitiative Lüchow Dannenberg und Mit-Initiator der
ersten Anti-Atomdemos im Wendland. Am 3. Mai jährt sich die Gründung der Republik
Freies Wendland zum 30. Mal.
http://fr-online.de/in_und_ausland/politik/doku_und_debatte/2608773_Gastbeitrag-von-
Wolfgang-Ehmke-Damals-ist-heute-im-Wendland.html
*****
Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
Info-tel 07141 / 903363
http://neckarwestheim.antiatom.net
x ------------ X -----------
x mailinglist des
x Aktionsbuendnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
x http://neckarwestheim.antiatom.net
x aus-/eintragen: Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
x ohne Subject, im Text: un-/subscribe abc